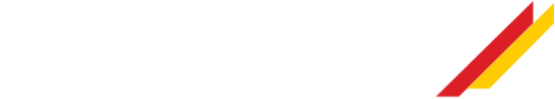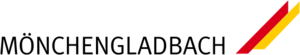Wärmeplanung
Die Wärmewende in Mönchengladbach
Wärmewende, Gebäudeenergiegesetz, kommunale Wärmeplanung - die Wärmeversorgung unserer Gebäude steht vor dem Hintergrund dringend notwendiger Klimaschutzmaßnahmen vor großen Veränderungen. Doch was bedeutet das für Mönchengladbach? Welche Rolle hat die Stadt? Und worauf müssen, können und dürfen sich die Bürgerinnen und Bürger der Vitusstadt einstellen? Auf diesen Seiten möchten wir Ihnen helfen, sich einen Überblick zu verschaffen und Antworten auf grundlegende Fragestellungen zu finden, die Sie vielleicht beschäftigen.
Ihre Fragen wurden hier nicht beantwortet?
Dann wenden Sie sich gerne per Mail an uns. Die Bearbeitungsdauer kann in Einzelfällen mehrere Wochen betragen.
Aktuelle Lage
Im September 2023 hat die Bundesregierung das Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden (Gebäudeenergiegesetz - GEG) aktualisiert. Damit soll der Wandel hin zu einer klimaschonenden Wärmeversorgung in Deutschland beschleunigt werden. Bestandteil der Gesetzesnovelle sind unter anderem Vorgaben dazu, in welchem Umfang neue Heizungsanlagen aus erneuerbaren Energien gespeist werden müssen.
Im November hat der Bundestag zudem das Gesetz für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze (Wärmeplanungsgesetz - WPG) verabschiedet. In dem Gesetz wird für Großstädte wie Mönchengladbach eine Wärmeplanung bis zum 30.06.2026 vorgeschrieben. Kern der Wärmeplanung ist die Ausweisung von Wärmenetzgebieten und Gebieten für dezentrale Wärmeversorgung auf Basis einer Bestands- und Potenzialanalyse mit der Maßgabe einer möglichst kosteneffizienten klimaneutralen Versorgung.
Wärme- und Energiewende - Mönchengladbach ist auf dem Weg
Die Stadt Mönchengladbach hat sich bereits vorher auf den Weg gemacht, Bedarfe und Potenziale der Energieversorgung (Strom + Wärme) in Mönchengladbach systematisch zu analysieren und daraus Antworten abzuleiten, wie die Energie- und Wärmewende in der Stadt gelingen kann. Seit Anfang 2023 wird in Zusammenarbeit mit einem externen Büro ein Energiekonzept erarbeitet. Noch 2024 wird mit der Fertigstellung des Konzeptes eine kommunale Wärmeplanung vorliegen, die dann von der Politik beraten und beschlossen werden muss. Unter anderem sollen klare Empfehlungen erarbeitet werden, in welchen Stadtgebieten zentrale (Wärmenetz) oder dezentrale Lösungen (Wärmepumpen) zu bevorzugen sind. Der Ausbau von Wärmenetzen hängt ganz maßgeblich davon ab, wo welche Wärmequellen derzeit und in Zukunft verfügbar sind. Das Energiekonzept (inkl. kommunaler Wärmeplanung) wird in enger Partnerschaft mit der NEW AG erarbeitet. Die NEW AG erarbeitet zeitgleich für ihr gesamtes Versorgungsgebiet eine Wärmeplanung. Das städtische Energiekonzept und die Untersuchungen zur Wärmeplanung der NEW AG erfolgen in enger Abstimmung.
Geothermie und Wärmepumpen
Häufige Fragen zu Geothermie und Wärmepumpen
Der Geologische Dienst NRW bietet einen ersten Standortcheck über folgendes Online-Portal: https://www.geothermie.nrw.de/
Je nach Wärmepumpenvariante werden Luft, Wasser oder Grundwasser als regenerative Wärmequelle für die Heizung genutzt. Zum Teil wird eine wasserrechtliche Erlaubnis benötigt. Weitere Informationen sowie Antragsformulare stellt die Untere Wasserbehörde bereit.
Grundsätzlich wird für Teile Mönchengladbachs ein großes Potenzial für Wärmeerzeugung erwartet. Dieses Potenzial soll mit einer Machbarkeitsstudie und ersten seismischen Untersuchungen näher betrachtet werden.
Das neue Gebäudeenergiegesetz (GEG) sieht entsprechende Förderungsmöglichkeiten vor, die aber noch konkret ausgearbeitet werden müssen. Einkommensunabhängig soll man einen Zuschuss von mindestens 30 Prozent erhalten.
Wärmeversorgungsinfrastruktur
Häufige Fragen zur Wärmeversorgungsinfrastruktur
Ein Gesamtkonzept für eine integrierte kommunale Energiewendestrategie inklusive kommunaler Wärmeplanung wurde Anfang 2023 beauftragt und wird 2024 in enger Zusammenarbeit mit der NEW AG und dem externen Dienstleister fertiggestellt. Das Konzept muss dann von der Politik beraten und beschlossen werden. Lesen Sie dazu unsere Pressemitteilung vom Februar 2023 sowie (im mittleren Abschnitt) die Pressemitteilung zum jährlichen Klimaschutzbericht von August 2023.
Nein, bisher gibt es noch kein Fernwärmenetz in Mönchengladbach. Im Rahmen der Erarbeitung eines Konzepts zur Energiewende wird aktuell untersucht, wo im Stadtgebiet der Aufbau einer Fernwärmenetzinfrastruktur besonders sinnvoll wäre. Ergebnisse werden für Anfang 2024 erwartet.
Derzeit liegen noch keine konkreten Auf- und Ausbaupläne vor. Aktuell wird ein Konzept zur Energiewende erarbeitet und 2024 fertig gestellt. Das Energiekonzept wird erste Anhaltspunkte liefern können, welche Stadtgebiete sich besonders für eine Fernwärmeversorgung eignen. Eine mögliche Umsetzung wird allerdings noch Jahre in Anspruch nehmen, weil das Fernwärmenetz von Grund auf neu angelegt werden müsste.
Beispielsweise über eine Solarthermieanlage kann ein Teil des häuslichen Wärmebedarfs abgedeckt werden. Eine Übersicht über die Möglichkeiten klimafreundlicher Wärmeerzeugung und -verteilung finden Sie hier auf den Seiten der Landesgesellschaft für Energie und Klimaschutz (nrw.energy4climate).
Der kommunale Wärmeplan liefert einen ersten Anhaltspunkt für die Bürger*innen, in welchen Stadtgebieten welche Art von Energieversorgung angestrebt wird, ob also eine zentrale Netzstruktur oder eine dezentrale Versorgung mit Einzellösungen wie Wärmepumpen sinnvoller erscheint. Der Wärmeplan soll nach seiner ersten Aufstellung kontinuierlich weiterentwickelt werden, um die Planungssicherheit für alle an der Wärmewende Beteiligten zu erhöhen.
Gesetzliche Vorgaben zu Energieträgern in Heizungen
Häufige Fragen zu gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich Energieträgern in Heizungen
Nein, eine funktionierende Heizungsanlage muss nicht ausgetauscht werden. Die bereits vorher gültigen GEG-Vorgaben bezüglich Heizungen, die älter als 30 Jahre sind, greifen allerdings weiterhin (§ 72 GEG: Betriebsverbot für Heizkessel, Ölheizungen > hier zum Nachlesen)
Kaputte Heizungen können repariert werden. Falls das nicht mehr möglich ist, gilt in der Regel eine Übergangsfrist von 5 Jahren. In dieser Zeit können übergangsweise noch Heizungsanlagen eingebaut, aufgestellt und betrieben werden, die nicht die Anforderungen von 65 Prozent erneuerbaren Energien erfüllen. Nach Ablauf der Frist muss der geforderte prozentuale Anteil allerdings erfüllt werden, z. B. durch einen Fernwärmeanschluss. Für Gasetagenheizungen kann eine Übergangsfrist von bis zu 13 Jahren gelten. Auch die Anschlussmöglichkeit an ein Wärmenetz kann die Dauer der Übergangsfrist beeinflussen.
Nach dem neuen Gebäudeenergiegesetz (GEG) dürfen in Neubaugebieten ab dem 01.01.2024 nur noch Heizungen eingebaut werden, die auf die Dauer zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden können. Für Neubauten in Baulücken greifen die gleichen Regeln wie für Bestandsgebäude. Im Bestand hängt der Stichtag der Gültigkeit des GEG von der Wärmeplanung der Kommunen ab. Das GEG greift auch im Bestand, sobald ein kommunaler Wärmeplan inklusive veröffentlichter Gebietsausweisung vorliegt.
Ja, der Einbau wird durch Mittel aus dem Klima- und Transformationsfonds gefördert und bis zu maximal 70 Prozent bezuschusst, einkommensunabhängig erhält man mindestens 30 Prozent. Bis 2028 gibt es zudem den "Klima-Geschwindigkeitsbonus" von 20 Prozent, der in den Folgejahren immer geringer wird. Nähere Informationen dazu finden Sie auf der FAQ-Seite zum Gebäudeenergiegesetz des Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz.
Der Einbau einer Gas(etagen)heizung ist nicht verboten. Heizungen mit fossilen Energieträgern dürfen ab dem 01.01.2024 allerdings nur noch eingebaut werden, wenn man sich vorher einer verpflichtenden Beratung unterzogen hat. Dies dient zur Aufklärung und zum Schutz der Bürger*innen, um vor steigenden Kosten im Rahmen der CO2-Bepreisung zu warnen und Alternativen aufzuzeigen.