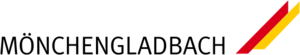Markus Vieten
Ardennenstr. 73a
52076 Aachen
Tel.: 02408/ 95 77 92
Fax: 02408/ 95 77 93
E-mail:mv@markusvieten.de
Homepage: www.markusvieten.de/
Biografie
Geboren am 1. Oktober 1965 in Mönchengladbach; 1971-1975 Katholische Grundschule Franz-Wamich; 1975 - 1984 Stiftisch-Humanistisches Gymnasium; 1984 - 1985 Zivildienst im Ev. Krankenhaus Bethesda; 1985 - 1992 Studium der Humanmedizin an der RWTH Aachen; Praktisches Jahr im Klinikum Aachen; 1992 - 1994 Arzt im Praktikum in der Praxis eines Nervenarztes und Psychotherapeuten; seit 1994 freiberuflicher Autor, Lektor und Projektleiter für medizinische Fachliteratur, Krimiautor.
Markus Vieten über sich: "Eigentlich sollte alles ganz anders werden... Nerv, Gehirn und Psyche waren die Begriffe, die mich elektrisierten. Großer Nervenarzt' oder bedeutender Hirnforscher' hießen die mittelfristigen Ziele. Doch das Medizinstudium offenbarte seine Schwächen und ließ für die Zukunft weniger Spaß erhoffen als vermutet. Auch Bücher hatten es mir recht früh angetan, doch bei meinen ungelenken Schreibversuchen auf alten Maschinen verhakten sich immer wieder die Arme der Buchstabenstempel und nach einer halben Stunde schmerzten meine Finger. Das ewige Getupfe und Gepinsele mit weißer Korrekturflüssigkeit tat ein Übriges. Dann entdeckte ich diese magische Maschine, die angeblich alles wußte und konnte. Doch in Wahrheit war sie dümmer als der Fernseher. Sie wusste nur, was ich ihr eingab. Aber das wenigstens behielt sie. Und sie ließ mich damit spielen, es verändern und neu gestalten. Federleichte Anschläge genügten, und wie von Geisterhand entstanden Texte in beliebiger Form und Farbe. Jetzt war es leicht zu schreiben, es brauchte keine Vorbereitung. Die Gedanken flossen direkt auf den Bildschirm, und die Ordnung konnte warten. Es entstanden die ersten Romane, und die Verbindung mit der Medizin war nur eine Frage von Zeit - und Geld."
Bibliografie
1996
Nebenwirkung, Kriminalroman. Elsdorf ISBN 3-927658-42-1
1996
Adaption von Ken Follett "Die Ratten von Nizza" als Krimi-Puzzle für den F.X. Schmidt-Verlag
1997
Beitrag zum Krimi-Kalender im Klein & Blechinger Verlag Fachbücher:
1993
Famulatur & PJ - Das Praxislexikon. Berlin ISBN 3-929891-00-X
1994
Berufsplaner Arzt. Berlin ISBN 3-929891-01-8
1996
Alternative Heilmethoden. Fortbildungswegweiser. Berlin ISBN 3-929891-06-9
1997
Handbuch der Arzthelferin. Berlin ISBN 3-929891-09-3
2000
Medical Skills. Arbeitstechniken für Famulatur und PJ. Stuttgart/New York ISBN 3-13-116113-2
2000
Handbuch der Tierarzthelferin. Stuttgart ISBN 3-7773-1446-3
2000
Handbuch der Hebamme. Stuttgart ISBN 3-7773-1445-5
2000
Handbuch für die orthopädische Arzthelferin. Stuttgart ISBN 3-7773-1692-X
2001
Neurologie, Psychiatrie. Lehrbuch und Atlas für Pflegende. München/Jena ISBN 3-437-25550-9
2001
Handbuch der ambulanten Pflege. Stuttgart ISBN 3-7773-31282-7
Weitere Titel auf der Homepage: www.markusvieten.de/
Leseprobe
Keine verhängnisvolle Affäre
Zwölf Gerdas, achtzehn Elisabeths und zweiundzwanzig Renates, das waren die Spitzenreiter von Toms Auswertung zufällig ausgewählter Telefonbuchseiten. Die Rechnung war ganz einfach: die Mehrzahl verheirateter Frauen war unter der Telefonnummer ihres Mannes aufgeführt, die Mehrzahl der alleinlebenden Frauen dürfte ein Verhältnis haben und in der Mehrzahl mit Männern, die verheiratet waren. Die Mehrzahl der im Telefonbuch aufgeführten Frauen hieß Renate, knapp vor Elisabeth, aber immerhin. Tom setzte in seinen vorbereiteten Serienbrief also den Namen Renate ein und druckte das ganze 200 mal aus. Er hatte die Namen der meisten Firmenchefs der Umgebung durch Telefonbuch, einen Anruf bei der Sekretärin oder die Internet-Homepage herausbekommen. Wo sie fehlten, richtete er das Schreiben einfach an den Geschäftsführer. Da er ohnehin einen anonymen Erpresserbrief geschrieben hatte, konnte er auf Anstandsfloskeln verzichten. Der Brief lautete so: Weiß alles über Renate. Mein Schweigen kostet Sie einmalig 50000.-. In einer Woche werde ich meine Informationen an die Personen weiterreichen, die sich wirklich dafür interessieren. Ihre Antwort erwarte ich im Postfach 770423.
Ganz schön heruntergekommen, aber was sollte er machen. Er fand einfach keinen Job, jedenfalls keinen, der ihn interessierte. Und einen Versuch war es wert. Wer kein Verhältnis mit einer Renate hatte, würde den Brief wie eine Werbesendung behandeln oder für einen schlechten Scherz halten. Aber wenn ein Firmenchef etwas mit einer Renate hatte, dann wurde es interessant. Tom war von seiner Idee so begeistert, daß er das Geld in Gedanken schon ausgegeben hatte. Er würde es einfach in einer anderen Stadt wiederholen. So wunderte es ihn auch nicht, daß er bald Antworten auf seine erpresserische Wurfsendung erhielt. Einer teilte ihm mit, daß er schon vor einigen Wochen mit seiner Frau gesprochen habe und deshalb nicht mehr erpressbar sei. Er wünschte Tom Krebs und AIDS an den Hals. Ein anderer beließ es bei den Verwünschungen. Schließlich entsprach einer Toms Vorstellungen: Unternehmen Sie nichts. Wir werden uns schon einig. Schlage Treffen vor zwecks Gespräch unter vier Augen. 20.4., 15.00 Uhr, Hauptbahnhof, Gleis 3. Halten Sie die letzte Ausgabe von "Capital" in der Hand. Das einzige Problem war, daß es keinen Absender gab. Und es kamen immerhin knapp 200 in Frage. Dumm gelaufen. Tom beschloß, der Einladung trotzdem zu folgen und war zur verabredeten Zeit dort. Auf dem Bahnsteig herrschte reger Betrieb. Unmöglich jemanden zu finden, den man nicht kannte. Er blätterte im "Capital" nach einer geeigneten Geldanlage. Vielleicht Aktien mit hohem Risiko und großer Gewinnchance. Er liebte das Risiko. Punkt 15.00 Uhr fuhr der Zug wieder ab und die letzten Personen verließen den Bahnsteig. Tom schaute sich mehrmals um. Er wollte gerade gehen, als er am anderen Ende des Bahnsteigs drei Männer stehen sah, die offenbar auf jemanden warteten. Schließlich erblickten sie ihn, stießen sich gegenseitig an und kamen auf Tom zu. Sie waren sehr gut gekleidet, Anzüge, Krawatten, blinkende Schuhe, und sehr, sehr kräftig. Nicht mal mit einem der Drei, die beim Näherkommen immer bedrohlicher wirkten, hätte Tom es aufnehmen können. Ihm wurde mulmig. Irgendwas lief falsch, nur Tom lief richtig, nämlich mit jedem Schritt schneller Richtung Ausgang. Als der Fußgängertunnel in die Bahnhofshalle mündete, huschte er kurz entschlossen in die Foto-Fix-Kabine. Er hörte die schweren Schritte seiner Verfolger vorbeilaufen. Als er vorsichtig herausschaute, sah er die Drei vor dem Bahnhof nach ihm Ausschau halten. Aber statt durchzuatmen, heftete er sich seinerseits an ihre Fersen. Schließlich wollte er reich werden, und offensichtlich war er auf eine Quelle gestoßen. Also behielt er sie aus sicherem Abstand im Auge, um ihnen im richtigen Moment in einem Taxi hinterherzufahren. Bald bog ihr Wagen auf das Firmengelände der KonKon, Konzen-Konfitüre. Tom ließ sich zurückbringen. Verstanden hatte er nichts. Natürlich hatte er auch an KonKon geschrieben, aber wieso brauchte ein Marmeladenhersteller solche Kerle fürs Grobe? Und alles wegen eines Verhältnisses?!
Zig, eigentlich Sigmund, hörte Tom, der sein Abenteuer zum Besten gab, kopfschüttelnd zu, während er weiter seiner Programmiertätigkeit nachging. "...zur Polizei kann ich schlecht gehen, auch wenn ich jetzt Schiß hab. Die würden mich direkt einlochen. Außerdem möchte ich trotz allem ganz gerne abkassieren, aber ich weiß nicht wie." Zig hätte sowas nie gemacht, aber er hatte auch einen prima Job und keine Geldsorgen.
"Hört sich an, als hättest du in ein Wespennest gestochen. Und du weißt sonst nichts von KonKon?"
"Nur was auf der Homepage stand, aber ich konnte natürlich nicht alle 200 Firmen studieren."
Zig gab ein paar Befehle in seinen Computer ein, bis KonKon mit der Homepage im Internet erschien.
"Marmelade, Marmelade... ah, hier haben wir auch ein paar andere Produkte: Süßigkeiten, Eingemachtes, Ketchup... und Chutneys."
Tom sah Zig fragend an.
"Was Chutney ist? Chutney kommt aus Indien, sehr würzig und süß, mit kleinen Fruchtstücken, nimmt man als Beilage oder Sauce, ziemlich lecker." Er wandte sich wieder dem Bildschirm zu. "Nichts besonderes dabei."
"Was ich sagte. Außerdem weiß ich nicht, was eine Renate mit Chutney zu tun haben soll."
"Offenbar soll wirklich niemand von Renate erfahren. Konzen wollte wohl kein Risiko eingehen, sich nicht mal informieren, was du gegen ihn in der Hand hast."
Es blieb fruchtlos, im Gegensatz zu Konzens Marmelade.
Tom begann in den folgenden Tagen und Nächten, Konzen und seine Firma zu observieren. Er hatte seinen Typ verändert, Haare kurz, getönte Fensterglasbrille, Tuchhose und Sakko. Aber er stellte nichts Außergewöhnliches fest. Konzen fuhr in seine Firma, nach Hause und zurück. Einige Recherchen und ein Hausbesuch in der Firma, bei dem sich Tom um einen Job bewarb, erbrachten keinen Hinweis auf eine Mitarbeiterin, Sekretärin oder sonst jemanden mit Namen Renate in Konzens Umgebung. Er war kurz davor aufzugeben, als Zig ihn anrief.
"Hast du die Zeitung gelesen", fragte er aufgeregt, ohne Toms Antwort abzuwarten, "in Frankfurt ist ein internationaler Waffenhändlerring aufgeflogen. Ihre Geschäfte hatten sie mit einem Kennwort getarnt: Jasmin."
Bei Tom fielen einige Groschen. Renate war womöglich keine Geliebte, sondern ein Codewort für illegale Geschäfte.
"Aber in Marmelade kannst du keine Waffen verstecken."
"Aber vielleicht Drogen", erwiderte Zig, "und vergiß nicht, Chutney ist sehr würzig, eignet sich, um Drogenhunde zu irritieren. Außerdem kommt es aus Pakistan, ich hab` mir die Angebote noch mal genau angesehen. Und in Pakistan baut man gerne Opium an."
Tom verschlug es die Sprache.
"Sieht aus, als wärst du noch mal davongekommen."
"Davongekommen? Jetzt machen wir denen erst richtig Feuer unterm Hintern! Ich bekomme nämlich langsam Spaß an der Geschichte."
Zig war überhaupt nicht wohl bei der Sache, aber gemeinsam setzten sie einen zweiten Brief auf, der so aussah:
Wenn Sie das nächste Chutney aus Pakistan in Empfang nehmen möchten, fahren Sie übermorgen am 26.4. um 16.00 alleine von Ihrem Firmengelände über die Ringstraße in Richtung Autobahn. Nehmen Sie ein Handy mit, das man von der Firma aus erreichen kann. Der Preis für die Extra-Mischung Chutney hat sich inzwischen verdoppelt!
Tom und Zig waren zur Stelle, als Konzen um 16.00 Uhr aus der Firma fuhr. Sie schlugen sich in die Hände und folgten ihm im sicheren Abstand. Gelegentlich schaute Zig, der fuhr, zur Sicherheit selbst in den Rückspiegel. Tom wählte die Firma an und ließ sich mit Konzen verbinden. Sie konnten erkennen, wie er telephonierte. Er lotste Konzen auf einen Autobahnparkplatz. Als Konzens Wagen stand, atmeten beide tief durch und parkten ihren fünfzig Meter hinter ihm. Tom wies Konzen an, den Koffer mit dem Geld neben sein Auto zu stellen und zu verschwinden. Es vergingen einige Momente. Tom und Zig rutschten nervös auf ihren Sitzen hin und her.
"Was macht er denn?", sagte Zig nervös und sah sich immer wieder um. Er hatte Angst, daß ihnen doch Konzens Gorillas gefolgt sein könnten, und er ließ das Lenkrad nicht einen Moment los, bereit, jederzeit wieder zu starten. Tom rief unterdessen mit dem Handy noch einmal Konzen an und drängte ihn, das Geld endlich zu übergeben. Dann öffnete sich die Fahrertür und eine Hand setzte einen Koffer ab.
"Na also!", rief Tom jubilierend. Zig lächelte jetzt auch, wenn auch etwas verhalten.
Als sich Konzens Wagen gerade wieder in Bewegung setzte, schoß ein weiterer Wagen an ihnen vorbei und versperrte Konzen den Weg. Zwei mit Pistolen bewaffnete Männer stürmten heraus, rissen Konzens Fahrertür auf und richteten die Waffen auf ihn. Zig geriet in Panik, versuchte den Zündschlüssel umzudrehen. Tom starrte völlig irritiert auf die Szenerie. Die beiden Männer legten Konzen Handschellen an und montierten ein seltsames Gerät über den Koffer. Dann wurden beide Türen ihres Wagens aufgerissen. Zig stieß einen kleinen Schrei aus.
"Tach, Inspektor Adlus, da haben Sie ja noch einmal Glück gehabt", sagte der Mann an Toms Seite. "Sie glauben doch nicht im Ernst, daß in dem Koffer Geld ist. Wahrscheinlich ist es eine Bombe, wie beim letzten Mal."
Tom und Zig bekamen keinen Ton heraus.
"Eigentlich gehören Sie eingesperrt, alle beide, aber durch Sie haben wir endlich was gegen Konzen in der Hand. Gute Arbeit!" Adlus klopfte Tom auf die Schulter. "Am Bahnhof konnten wir Sie noch schützen, aber das hier wäre beinahe schief gegangen."
"Wieso wußten Sie Bescheid", fragte Tom zitternd.
"Wir überwachen Konzen schon seit Monaten. Dazu gehört natürlich auch seine Post."
Ein Beamter kam von Konzens Fahrzeug mit dem Koffer herüber. Tom und Zig sanken immer tiefer in die Sitze.
"Das ist übrigens für Sie", sagte der Beamte und öffnete vor ihren Augen den Deckel. Zig schlug reflexartig die Arme vors Gesicht. Als der Knall ausblieb, nahm er sie vorsichtig wieder herunter und schaute in den Koffer. Auf einer Kollektion verschiedener Marmeladensorten lag ein Zettel: Guten Appetit wünscht Renate.
Dr. Roberts
Sein Herzschlag langweilte ihn.
Es klopfte ewig gleich in seinen Ohren, wenn er sich darauf konzentrierte. Er hörte die Frau, die ihm gegenüber saß, überhaupt nicht mehr. Sie wirkte sehr alt, dabei war sie gerade einmal zehn Jahre älter als er. Dafür verachtete er sie am meisten. Diese Frau, die über Verstopfung klagte und ihm gerade ihr Herz darüber ausschüttete, dass sie den Kontakt zu ihrer Tochter und dem kleinen Enkelkind mehr und mehr verlor, war das Lebensende, war Alter, Leid, Klagen und Verderben, und damit hatte er nichts zu tun - zumindest solange er nicht in den Spiegel schaute.
"Wenn ich mit ihr telefoniere, ist es, als redete ich mit einer Wand." Sie schaute auf ihre Hände, die unruhig am Saum ihrer Strickjacke nestelten. So oder ähnlich hatte er diese Geschichte schon tausendmal gehört.
Er nickte verständnisvoll und überlegte, was er am Abend essen sollte. Früher einmal hatte er leidenschaftlich gerne gekocht. Aber das war, als er noch ein Leben hatte, lange bevor er seinen Sohn Tim zu dieser Untersuchung brachte. Es ging eigentlich um eine fragliche genetische Erkrankung in der männlichen Erbfolge, die aber bei Tim nicht vorkam - nicht vorkommen konnte, denn er hatte keines der genetischen Merkmale seines Vaters. Er war ein Kuckucksei.
Aber Fred liebte ihn auch jetzt noch wie einen eigenen Sohn. Seine Ehe hatte diese Entdeckung jedoch nicht ausgehalten. Nach einem Jahr Zeter und Mordio warf Fred das Handtuch. Sie lebte jetzt im Süden und Tim war bei ihr. Er sah ihn einmal im Monat, es war eine Schande.
Fred zückte den Rezeptblock.
"Ich werde Ihnen ein pflanzliches Pärparat verschreiben, damit Sie besser einschlafen können. Und - versuchen Sie daran zu arbeiten", sagte Fred und schaute der Frau eindringlich in die Augen.
"Ja, Herr Doktor, vielen Dank. Soll ich dann in zwei Wochen wiederkommen?"
"Ja, bitte, und lassen Sie sich vorne von Evelyn einen Termin geben."
"Ist gut, Herr Doktor, und nochmals vielen Dank." Sie ergriff mit beiden Händen seine rechte.
In diesem Augenblick öffnete Evelyn die Türe.
"Ich wollte doch heute etwas früher Schluss machen", erinnerte sie ihren Chef.
"Ja, ja, gehen Sie nur. Ich schließe dann alles ab."
Evelyn nahm die Frau mit nach vorne zur Anmeldung, um ihr einen neuen Termin zu geben.
Fred machte sich ein paar Notizen.
Wenig später hörte er, wie beide die Praxis verließen. Im nächsten Moment läutete das Telefon.
Es war ihm lange nicht mehr passiert, aber jetzt griff er reflexartig nach dem Telefon, noch bevor sich der Anrufbeantworter einschalten konnte.
"Gut, dass ich Sie noch erwische, Herr Doktor. Hier ist Lucilla Johnson, die Pflegerin von der alten Miss Perkins. Ich glaube, es geht ihr gar nicht gut. Sie sollten besser vorbeikommen. Ich bekomme sie gar nicht mehr richtig abgesaugt."
Er hätte sich ohrfeigen können. Warum konnte er nicht die Finger vom Telefon lassen!?
"Äh, ja, guten Abend, Mrs. Johnson. Das war ja zu erwarten. Ist es denn akut?"
"Nein, so schlimm auch wieder nicht. Sie muss einfach besser abgesaugt werden, und ich weiß, dass Sie da ein besonders Händchen für haben, Herr Doktor. Wenn ich den Notarzt rufe, steckt er sie ins Krankenhaus. Sie wissen, dass das ihr Ende wäre..."
"Ja, natürlich, damit haben Sie vollkommen recht. - Also gut, ich werde mich gleich auf den Weg machen. Wollte sowieso gerade Schluss machen."
Er hatte den Schwarzen Peter gezogen. Aber es half nichts - er musste hin. Es würde also auch heute Abend nichts mit dem Kochen werden. Wenn er von Miss Perkins nach Hause käme, würde es gerade noch für eine Pizza reichen. Aber es hatte auch etwas für sich: Er musste seine Gewohnheiten nicht ändern, und das Kochen provozierte nur unliebsame Erinnerungen.
Zwanzig Minuten später war er vor Miss Perkins kleinen Haus angelangt. Als er mit der Arzttasche in der Hand aus dem Wagen stieg, öffnete Mrs. Johnson die Haustüre, um ihn zu empfangen.
"Gut, dass Sie kommen, Doktor, ich habe schon alles versucht, aber ich bekomme ihre Atemwege einfach nicht frei. Es geht ihr jetzt doch viel schlechter."
"Ich werd sie mir mal ansehen", sagte Doktor Roberts, während er an ihr vorbei das Haus betrat.
Er war schon ein paar Wochen nicht mehr dort gewesen. Es roch penetrant nach Eukalyptus und Waschlotionen, was den darunter liegenden Geruch von Sputum, Inkontinenz und alten Polstermöbeln leidlich überdeckte. Fred war diese Kombination von Gerüchen bereits so vertraut, dass selbst der frische Eukalyptus für ihn nach Verfall und Tod roch.
Der Hausflur war eng und stockfinster. Am seinem Ende zweigte das Wohnzimmer ab, in dem Miss Perkins in ihrem Pflegebett lag. Er hörte ihr hilfloses Röcheln.
Sie hatte deutlich nachgelassen seit seinem letzten Besuch. Zwischen Kissen, Bettdecke und den Schläuchen vom Beatmungsgerät, dem Katheter und der Infusion war sie kaum noch richtig zu erkennen. Er stellte seine Tasche ab und holte einen frischen, steril verpackten Absaugkatheter heraus.
"Ähm, Herr Doktor", sprach ihn Mrs. Johnson von hinten an, "ich bin schon sehr spät dran und habe noch vier Patienten vor mir. Kommen Sie alleine zurecht?"
"Wie? Ja,ja... Machen Sie sich keine Gedanken. Ich komme schon klar, vielen Dank. Auf Wiedersehen."
Sie konnte hier nichts mehr tun. Er hatte in seiner Krankenhauszeit so vielen Kranken die Atemwege abgesaugt, dass es ihm keine große Mühe bereitete. Für die meisten Pflegekräfte war es der reinste Horror. Die Erstickungsangst während der Prozedur war auch von einer "erfahrenen" Patientin wie Miss Perkins nicht zu unterdrücken.
"Hallo, Miss Perkins, ich bin es, Doktor Roberts", sagte er und legte seine Hand auf ihren dünnen Unterarm.
Sie wandte ihm das Gesicht zu und schloss einen Moment die Augen. Ihr Mund formte ein paar stumme Worte. Er beugte sich ein wenig zu ihr herab und nahm den süßlichen Geruch einer kranken Lunge war. Aber außer dem Rasseln in den Bronchien konnte er nichts verstehen. Sie würde es nicht schaffen. Vielleicht noch ein paar Tage, höchstens, dann hatte die arme alte Frau endlich Frieden.
"Ich muss Sie noch einmal absaugen", sagte er. Miss Roberts Augen sahen ihn flehend an. Sicher hatte die Pflegerin es auch schon einige Male versucht. Er musste es jetzt richtig machen.
"Sie wissen, es führt kein Weg daran vorbei. Mir ist klar, dass Sie das sehr mitnimmt, Miss Perkins. Ich werde es so kurz wie möglich machen." Ihr Blick war so traurig.
Es war grausam. Er wusste, was er täte, wenn es jemals so weit mit ihm käme - so fern er es dann noch selber in der Hand haben würde. Miss Perkins jedenfalls hatte diese Gelegenheit schon verpasst.
Er schloss den Absaugkatheter an das Gerät an und schaltete es ein. Ein zischendes Geräusch zeigte den Sog auf dem dünnen Schlauch an. Fred nahm ihre Sauerstoffsonde von der Nase und bat sie, den Mund zu öffnen. Als sie nicht gleich reagierte, übernahm er es mit routinierten Handgriffen selbst. Miss Perkins war nur noch ein wehrloses und armseliges Geschöpf. Er schob ihr den Schlauch in den Mund und zügig weiter vor, um in die Luftöhre zu gelangen. Miss Perkins würgte kurz und wurde dann sehr unruhig, während der Schlauch bereits zähen, gelben Schleim förderte, den sie aus eigener Kraft nicht mehr abhusten konnte. Danach würde sie wieder für einen Tag etwas Ruhe haben, dachte Fred, und schob den Schlauch noch weiter vor. Miss Perkins versuchte zu husten, Tränen traten ihr in die Augen, entweder wegen der Reizung oder wegen des Leids oder beidem. Mehrfach bäumte sich ihr Körper auf. Die ganze Prozedur dauerte gerade eine Minute, für Miss Perkins eine halbe Ewigkeit. Dann zog Fred den dünnen Schlauch wieder heraus.
"So, Sie haben es überstanden. Jetzt ist es wieder besser, oder?"
Das Rasseln in ihrer Lunge war deutlich schwächer geworden. Sie sah jetzt wieder etwas wacher aus, aber das war eher der Anstrengung und Angst zuzuschreiben als der verbesserten Atmung.
Er lächelte sie an, während er die Absaugvorrichtung ausschaltete und den Katheter entsorgte. Miss Perkins versuchte erneut etwas zu sagen und Fred beugte sich abermals zu ihr herunter. "Ich kann das nicht mehr", hörte er sie schwach sagen, "helfen Sie mir!"
Er wollte etwas Aufmunterndes erwidern, wie er es immer tat, aber irgendetwas hielt ihn zurück. Er schaute in ihre Augen und da war dieses Flehen, dass ihm schon vor dem Absaugen aufgefallen war.
"Bitte!", sagte sie laut und deutlich und ihm war mit einem Male klar, was sie wollte und dass es ihr damit ernst war. Nicht dass es ihn gewundert hätte oder dass es für ihn eine neue Erfahrung gewesen wäre - jeder konnte es sehen und jeder dachte, dass der Tod für sie eine Erlösung sein musste. Aber zum ersten Mal spürte er, dass er es auch tun wollte, er sah es deutlich vor sich.
Sie waren ganz alleine, niemand würde es sehen. Und ob Sie heute oder zwei Tage später sterben würde, machte nur für sie selber einen Unterschied.
Ohne ein weiteres Wort, ohne noch einmal nachzudenken, hob er vorsichtig ihren Kopf hoch und zog das große Kissen hervor. Er nahm es fest in beide Hände und drückte es auf ihr Gesicht. Er hörte ein kurzes, schwaches Stöhnen, dann war es still. Die ersten Sekunden waren ganz leicht, bis ihm bewusst wurde, was er tat. Ein Glühen kroch seinen Rücken herauf und entlud sich brennend unter seiner Schädeldecke. Sein Atem ging immer schneller, der Druck auf das Kissen erhöhte sich. Er war kurz davor, wieder aufzuhören, als Miss Perkins begann, um sich zu schlagen und mit den Beinen zu strampeln. Ihr Infusionsschlauch trommelte in einem bizarren Rhythmus wieder und wieder gegen den Nachtschrank, auf dem sich nur noch Pflegeutensilien und ein Notrufgerät befanden.
Einmal traf ihn ihre Hand und er glaubte einen Moment lang, dass ihn der Zugang auf ihrem Handrücken am Auge verletzt habe. Fred erhöhte abermals den Druck und stützte sich jetzt mit seinem ganzen Gewicht auf das Kissen, das Miss Perkins Gesicht vollständig unter sich begrub. Sein ganzer Körper zitterte vor Anstrengung und er atmete schwer. Endlich ließ das Schlagen und Strampeln nach, um abrupt zu enden. Er hätte unmöglich sagen können, wie lange es gedauert hatte. Es konnte kaum mehr als eine Minute gewesen sein, vielleicht weniger, aber er fühlte sich wie nach einem Tausendmeterlauf. Langsam nahm er den Druck vom Kissen und hob es von ihrem Gesicht ab.
Ihre Augen waren weit aufgerissen und starr, auch ihr Mund stand ganz offen. Ein Büschel grauer, dünner Haare klebte auf ihrer Stirn fest. Fred wich ein Stück zurück. Den Anblick hatte er erwartet - und erhofft. Er hielt immer noch das Kissen in beiden Händen, und noch während er sie ansah, dachte er daran, ihren Tod noch medizinisch korrekt überprüfen und dokumentieren zu müssen.
Er hatte gerade das Kissen auf das Bett gelegt, als Miss Perkins sich leicht aufrichtete und einen lauten und tiefen Seufzer tat.
Fred schrie auf, Adrenalin jagte durch seinen Körper. Er griff sofort nach dem Kissen und drückte es wieder auf Miss Perkins Gesicht, fester denn je. Er drückte und presste, fluchte und schimpfte. Nach weiteren endlosen zwei Minuten ließ er schließlich von ihr ab. Er war vollkommen außer Atem. Sein Herz schlug wie wild. Als er das Kissen wieder fortnahm, hatte sich ihr Gesicht abermals verändert. Augen und Mund waren geschlossen, so als schliefe sie tief - und friedlich.
Fred ließ sich auf einen Stuhl fallen und begrub sein Gesicht in den Händen, während er sich erholte. Er musste plötzlich lachen. Er fühlte sich nicht schuldig wegen seiner Tat. Jedes Gericht der Welt würde die Sterbehilfe darin erkennen, auch wenn seine Methode sehr unkonventionell war. Aber was ihm ein wenig Unbehagen bereitete und gleichzeitig das Lachen entlockt hatte, war der Umstand, dass er sich ungeheuer lebendig fühlte, wie nach einer kalten Dusche oder einer Achterbahnfahrt - trotz seiner weichen Knie ein irres Gefühl, ein Rausch! ( ... )
(Beitrag aus: Mörderisch : der Krimi-Kalender, erschienen bei Klein und Blechinger in Elsdorf, 1997)